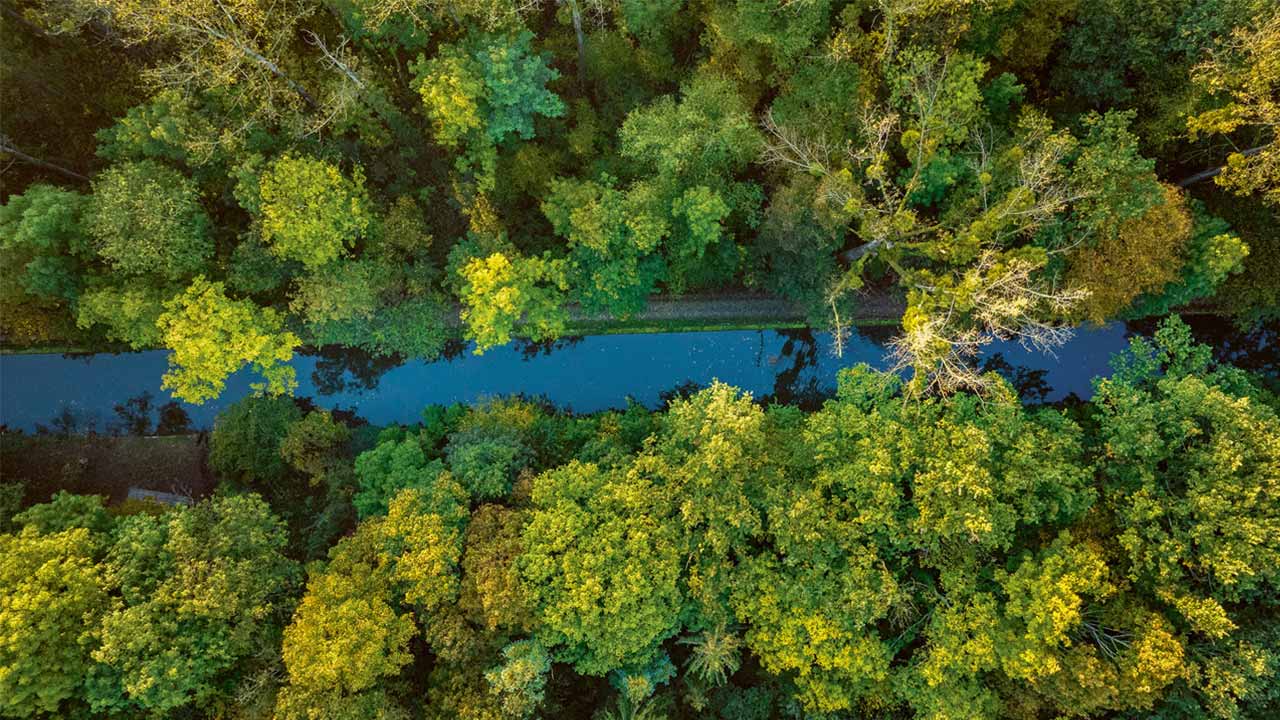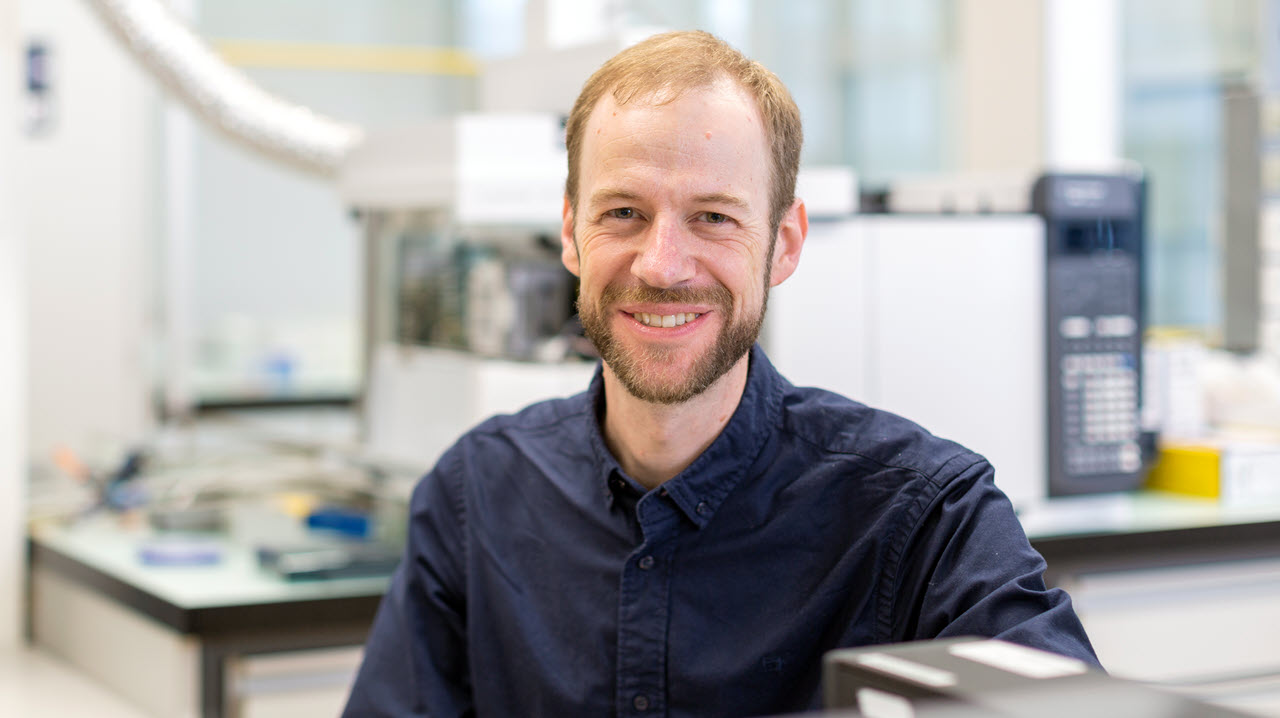Magazin
Im Gespräch
«Die Ereignisse werden zunehmen», sagt die Wasserexpertin

Der Klimawandel verändert in der Schweiz auch den Umgang mit dem Wasser, meint Prof. Manuela Brunner im Interview.
Frau Brunner, wir haben ein Jahr mit viel Niederschlag hinter uns. In den Alpen gab es grosse Überschwemmungsschäden. Ist das «das neue Normal»?
Das Jahr 2024 war auf jeden Fall ereignisreich. Vor allem haben wir viele verschiedene Arten von Ereignissen beobachten können. Das waren einerseits wasserbedingte Schäden wie zum Beispiel Hochwasser, aber auch sogenannte gravitative Naturgefahren, also Erdrutsche oder Murgänge, bei denen Wasser mit Fels und Sand eine Schlammlawine formt. Ob das nun «das neue Normal» darstellt, ist eine gute Frage. Ich denke, dieses Jahr war ein Vorgeschmack auf die erhöhte Variabilität, die uns erwartet. Also auf grössere Schwankungen zwischen Jahren mit viel Wasser oder solchen mit wenig Wasser. Die Vorhersagen – wir reden von Projektionen – zeigen, dass diese Schwankungen von Jahr zu Jahr zunehmen. Das bedeutet einerseits mehr Extremereignisse, aber andererseits auch, dass die Wasserverfügbarkeit von Jahr zu Jahr unterschiedlich ist.
Und der Grund für diese Veränderung ist der Klimawandel?
Der Grund sind die tendenziell zunehmenden Temperaturen, ja. Steigende Temperaturen haben zur Folge, dass die Atmosphäre mehr Wasser aufnehmen kann. Dadurch wird sie gewissermassen «explosiver». Es kann insgesamt mehr Niederschlag auf die Erde fallen und dort Extremereignisse auslösen. Diese werden in Zukunft häufiger vorkommen.
Sie sind Professorin für Hydrologie und Klimafolgen in Gebirgsregionen an der ETH Zürich und am SLF in Davos. Erklären Sie kurz, was Sie tun.
Meine Forschungsgruppe und ich studieren Extremereignisse, die in irgendeiner Form etwas mit dem Wasserkreislauf zu tun haben. Das können Hochwasser sein, aber auch Trockenheit, Waldbrand oder extreme Wassertemperaturen. Wir fragen, wie solche Extremereignisse entstehen. Welche Faktoren müssen zusammenkommen, damit zum Beispiel ein Hochwasser entsteht? Dann befassen wir uns mit der Frage, wie sich die Häufigkeit, aber auch die Stärke dieser Extremereignisse verändert. Um diese Fragen zu beantworten, entwickeln wir Modelle. Das können statistische Modelle, aber auch prozessbasierte Modelle sein. Diese Modelle füttern wir mit verschiedenen Datensätzen, die das Klima oder das Wetter beschreiben. Das Modell zeigt uns dann, wie sich der Abfluss von Flüssen in Zukunft verändert.

In der Schweiz haben viele Gruppen Interesse am Wasser. Wer wird in Zukunft besonders gezwungen, sich anzupassen – zum Beispiel durch Extremereignisse?
Wir untersuchen die Entstehung von Wasserknappheit, also, ob zu einem bestimmten Zeitpunkt in einer bestimmten Region genügend Wasser zur Verfügung steht, um den Bedarf zu decken. Der Bedarf kann in der Landwirtschaft anfallen, in der Wasserkraftproduktion, der Industrie, der Schifffahrt und so weiter. Dabei sehen wir, dass insbesondere im Sommer vermehrt mit Nutzungskonflikten zu rechnen ist. In vielen unserer Modelle haben die Flüsse im Sommer weniger Abfluss. Alle, die dann im Sommer Wasser brauchen, insbesondere die Landwirtinnen und Landwirte, geraten unter Druck. Denn einerseits steht weniger Wasser zur Verfügung, und andererseits nimmt der Wasserbedarf zu. Wenn ich beispielsweise Mais anpflanze, braucht der viel Wasser, wenn es heiss ist, denn dann kommt es zu mehr Verdunstung auf den Feldern. Gleichzeitig herrscht dann auf der Angebotsseite möglicherweise Knappheit. Das kann aufgrund fehlender Schneeschmelze sein oder weil die Niederschläge ausbleiben. Im Falle der Wasserknappheit gibt es bereits heute einen Anpassungsdruck.
Kann man diese Knappheit überhaupt entschärfen? Beim Angebot zumindest sind wir doch der Natur ausgeliefert, oder?
Zunächst haben wir auf der Nachfrageseite sehr grosse Hebel, um den Verbrauch zu steuern. Wenn wir Wasser sparen müssen, können wir unsere Nutzung meist auch anpassen. Und man kann durchaus die Angebotsseite beeinflussen. In den Berggebieten wird zum Beispiel das Wasser aus der Schneeschmelze im Sommer zwischengespeichert. Das machen heute vor allem die Elektrizitätsunternehmen, die das Wasser in Speicherseen auffangen, um damit im Winter Strom zu produzieren. Solche saisonalen Verlagerungen sind auch für andere Anwendungen denkbar. Man kann das Wasser auch im Frühling für die Landwirtschaft zwischenspeichern, die es im Sommer braucht. Das wird momentan noch wenig gemacht, aber es wäre grundsätzlich möglich. Die Frage ist natürlich, ob man dazu neue Speicher baut. Das ist erstens ein grosser Eingriff in die Natur und zweitens politisch zurzeit in der Schweiz nicht einfach durchsetzbar. Das sieht man bei den Diskussionen zum Ausbau der Wasserkraft. Man kann aber Wasser auch dezentral zwischenspeichern. Wenn ich eine Bäuerin im Seeland wäre, könnte ich mir überlegen, auf meinem Land einen See oder einen Teich anzulegen.
… oder Wassertanks aufstellen, wie wir sie aus alten amerikanischen Filmen kennen.
Genau. Das gibt es ja bereits. Manche Leute haben im Garten einen Tank, mit dem sie das Regenwasser auffangen. Das kann man natürlich auch im grösseren Stil machen, aber so weit sind wir in der Schweiz aktuell noch nicht. Es gibt erste Projekte zu Wasserspeichern im Berner Seeland, im Kanton Aargau und im Kanton Basel-Landschaft, wo die Juraflüsse im Sommer schon heute sehr wenig oder kein Wasser führen.
Wir haben von Murgängen und zerstörten Strassen in den Alpen geredet, vertrockneten Feldern im Mittelland und dem Baselbiet. Muss sich eine Stadt wie Basel auch auf Extremereignisse vorbereiten?
Es kommt ganz darauf an, von welcher Naturgefahr man redet. Steinschlag und Murgänge sind für Basel weniger relevant. Was dort in Zukunft aber relevanter wird, ist das Hochwasserrisiko, das vom Rhein ausgeht. Das Hochwasserrisiko in Flüssen nimmt tendenziell zu, vor allem im Winter, da dann die Niederschläge zunehmen. In den Alpen sieht das in gewissen Gebieten anders aus. Die typischen Frühlingshochwasser gehen eher zurück, da die Schneeschmelze abnimmt. Was in der Stadt Basel neben der Hochwassergefahr, die vom Rhein ausgeht, auch wichtiger wird, sind Hochwasser durch Oberflächenabfluss. Starkniederschlag kann in der Stadt schlecht abfliessen, da viele Flächen versiegelt sind. Solche Niederschläge werden im Sommer zunehmen, auch in Basel.
Der Mensch ist abhängig vom Wasser. Deshalb muss er sich zum Wasser begeben.
Wasser ist mal Ressource, mal Bedrohung. Können wir diesen Widerspruch auflösen?
Ich glaube, das versuchen wir schon seit Jahrtausenden. Der Mensch ist abhängig vom Wasser. Deshalb muss er sich in Regionen begeben, wo es Wasser gibt. Manchmal gibt es dort zu viel davon, und der Mensch ergreift Schutzmassnahmen. Heute haben wir dafür ein vielfältiges Risikomanagement. Wir schützen uns entweder mit naturbasierten Lösungen, indem wir zum Beispiel dem Wasser genügend Raum geben, oder wir erstellen Schutzbauten wie Deiche oder Dämme, um zum Beispiel Industriezonen vor zu viel Wasser zu schützen.
Ist denn auch denkbar, dass die Gefahren mancherorts so gross werden, dass nichts anderes übrigbleibt, als sich zurückzuziehen?
Das wird momentan in der Schweiz noch sehr wenig diskutiert, aber es kann in gewissen Fällen Sinn machen. Wenn ich an einem Fluss lebe, der bisher alle 50 Jahre vom Hochwasser betroffen war, und es sind in Zukunft 20 oder sogar 10 Jahre, dann muss ich mir überlegen, wie ich damit umgehe. Umsiedlung ist bei uns verpönt. Aber ich glaube, wir werden zumindest darüber diskutieren müssen. Wann werden die Kosten für die Gesellschaft zu gross, jemandem das Leben an einem Ort zu ermöglichen, wo es zu gefährlich ist?
Wer ist heute überhaupt für das Management unserer Gewässer zuständig?
Das machen die Gemeinden und Kantone. Sie vergeben die Konzessionen für die Wassernutzung an verschiedene Nutzer. Das kann die Landwirtschaft sein, das kann ein Skigebiet sein, das kann ein Elektrizitätswerk sein.
Wie funktioniert das an grossen Flüssen?
Dort gibt es eine kantonale Koordination und Stellen, die regeln, wer im Ereignisfall wie viel Wasser abfliessen lassen darf. Wenn man bei Hochwasser in Thun alle Schleusen öffnet, hat man in Biel ein Problem. Auch die Wasserkraftwerke können bei Hochwassergefahr Wasser in den Stauseen zurückhalten. Ähnliche Abkommen gibt es auch auf internationaler Ebene.
Die Schweiz gilt als Wasserschloss Europas, wir befinden uns wortwörtlich an der Quelle vieler europäischer Gewässer. Können wir gelassener in die Zukunft blicken als andere Länder?
Das Bild vom Wasserschloss ist schon stimmig, denn wir sind in der Schweiz bezüglich Wasser sehr privilegiert. Doch auch im Wasserschloss gibt es Schwankungen, die, wie gesagt, grösser werden. Auch wir sind betroffen, wenn es in einem Jahr weniger Wasser gibt. Und es zeichnet sich ab, dass wir die Schneespeicher langsam verlieren. Das ist auch für die Unterlieger wichtig. Das Wasser, das im Winter gespeichert worden wäre, fliesst dann ab. Dabei geht es um grosse Mengen: Rund 40 Prozent des Wasserabflusses pro Jahr stammen bei uns aus der Schneeschmelze.
Wie bereiten wir uns am besten auf die Zukunft vor? Sind es mehr bauliche Massnahmen, oder braucht es auch Verhaltensänderungen? Energiesparen ist ja auch wieder zum Thema geworden.
Ja, Sparen wird als Thema wichtiger. Das ist in den letzten Jahren auch schon passiert. In einzelnen Tessiner Gemeinden wurden die Leute im Sommer angehalten, zum Beispiel ihre Autos nicht mehr zu waschen oder ihre Swimmingpools nicht mehr zu füllen. Solche Knappheitssituationen wird es in Zukunft auch in der Nordschweiz vermehrt geben. Allgemein müssen wir uns alle darauf einstellen, dass nicht nur die Angebotsseite alles auffangen wird, sondern auch die Nachfrageseite, also wir Konsumentinnen und Konsumenten.
Haben wir überhaupt das Potenzial, individuell viel Wasser zu sparen? Eine gewisse Menge Wasser brauchen wir doch alle.
Gerade in der Landwirtschaft ist das Potenzial sehr gross. Ob man Tröpfchenbewässerung einsetzt oder Sprinkler, die das Wasser einfach in die Atmosphäre blasen, das macht einen grossen Unterschied. Der Verbrauch in den Haushalten ist verglichen mit anderen Nutzungen tatsächlich sehr klein. Aber trotzdem kann jede und jeder sparen. Man kann eine Sparbrause einsetzen, man kann die WC-Spülung effizient nutzen, also den kleinen Knopf statt den grossen drücken. Das ist in der Gesamtbetrachtung nicht der grösste Anteil, aber bezogen auf den eigenen Alltag lässt sich viel ändern.
In der Vergangenheit haben die Menschen in der Schweiz schon einmal mit knappem Wasser umgehen können. Man denke an die Suonen und Wasserrechte im Wallis. Können wir davon etwas lernen?
Ja, in Bezug auf Wassernutzung können wir auf jeden Fall von Gebieten etwas abschauen, die schon Erfahrung im Umgang mit Wasserknappheit haben. Das kann das Wallis sein, das in der Schweiz schon immer mit Trockenheit zu kämpfen hatte. Aber auch unsere Nachbarländer hatten da schon manche gute Idee. Inspiration gibt es genug.
Zur Person
Manuela Brunner ist Assistenzprofessorin am Institut für Atmosphären- und Klimawissenschaften der ETH Zürich und am WSL-Institut für Schnee- und Lawinenforschung SLF in Davos. Stationen der Geografin und Klimawissenschaftlerin waren unter anderem Grenoble (F) und Boulder, Colorado (USA). Aktuell untersucht sie das Gefahrenpotenzial und die Wasserverfügbarkeit in Bergregionen unter dem globalen Wandel.
Erfahren Sie mehr dazu
Das könnte Sie auch interessieren